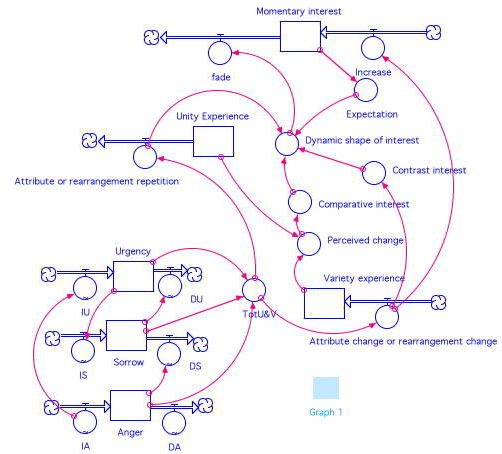|
Körperlose Musik? Die Internationale Computermusikkonferenz (ICMC) 2000 in Berlin von William Osborne und Abbie Conant MusikTexte Heft 86/87 – November 2000 Die Internationale Computermusik-Assoziation (ICMA) ist
eine akademische Organisation aus Komponisten, Interpreten, Ingenieuren und
Wissenschaftlern, die an der Anwendung digitaler Medien auf die Musik arbeiten.
Die Zusammensetzung ihrer Mitglieder ist international, und die Konferenzen
wechseln sich zwischen den Amerikas, Europa und Asien ab. Die jüngste wurde
vom 27. August bis zum 1. September in Berlin abgehalten und umfaßte zwölf
Konzerte mit neuer Musik (mit annähernd siebzig Kompositionen) und über
hundertdreißig Vorträgen, die auch in den 563 Seiten starken
„proceedings“, dem Kongreßbericht, veröffentlicht waren. Die
Veranstalter hatten darüber hinaus eine Compactdisc, die zehn der im Festival
aufgeführten Kompositionen
enthielt, produziert. Von morgens früh bis abends spät fanden oft zwei bis
vier Veranstaltungen gleichzeitig statt. Schließlich gab es ein
Zusatzprogramm im Berliner Podewil, das weitere Konzerte und eine Reihe
Workshops enthielt. Das Eröffnungskonzert bestand in einer der seltenen Aufführungen
von John Cages Komposition „HPSCHD“ (eines der ersten wichtigeren
Beispiele für Computermusik), die über fünfzig im Foyer der Berliner
Philharmonie [wo das Werk 1972 seine Uraufführung erlebte] installierte
Lautsprecher wiedergegeben wurde. Als diese anfingen, von überallher
metallische Flitter entkleideter Barock-Klänge abzustrahlen, entstand eine
andächtige Stille, aber schon nach wenigen Minuten begann das Publikum, das
in Gruppen herumstand, wieder zu reden und setzte seine Gespräche für die
einstündige Dauer der Aufführung fort. So blieb das Konzert eine ehrenwerte
Anstrengung, die vom Publikum nicht wirklich anerkannt wurde. Vielleicht ist
Musik, die aus Foyer-Lautsprechern kommt, zu allgegenwärtig geworden. Innerhalb der Konferenz gab es eine Reihe von Sitzungen
zum Thema „physical modeling“. Der Ansatz dabei ist, eine Software zu
entwickeln, die einen Instrumentalklang nicht nur nachahmen kann, sondern auch
seine akustischen Grundlagen und Besonderheiten in der Aufführung berücksichtigt.
So kann die eigene Qualität der Instrumente über elektrische Tastaturen
wiedergegeben werden – synthetische Klarinetten, die das Quieken von
schiefen Rohrblättern nachmachen können, oder den angespannten Luftdruck,
der bei Trompeten durch halb gedrückte Ventile oder Überblasen des Tons
entsteht. Forschungen im Ircam haben diese Modelle so weit perfektioniert, daß
sie fast so schwer zu spielen sind wie die akustischen Instrumente, die sie
ersetzen. Der nächste Schritt ist, Modelle für das Spiel bestimmter Musiker
zu entwickeln. Man könnte zum Beispiel einige von Coltranes Eigenarten des
Saxophonspiels digital simulieren. In achtzehn Sitzungen wurden konkrete neuere
Forschungsergebnisse vorgestellt. Adrian Freed vom Center for New Music and
Audio Technology an der University of California demonstrierte eine Tastatur,
die während des Niederdrückens oder Loslassens einer Taste ständig
Informationen über die Vorgänge liefert. Über eine Ethernet-Verbindung wird
das Gerät an ein Notebook angeschlossen und ermöglicht neben vielen anderen
Anwendungen die einer expressiveren und authentischeren digitalen Tastatur.
Perry Cook und Colby von der Princeton University stellten zwei „squeezeVoxes“
genannte, stark modifizierte Akkordeons vor, die durch die Instrumentenbälge
eine „physical-modeling“-Software steuern, mit der die menschliche Stimme
synthetisiert wird. Tomoko Yonezawa und Kenji Mase stellten einen
klavierspielenden Springbrunnen vor. Geschwindigkeit, Ambitus und Lautstärke
der Musik ändern sich dabei in Übereinstimmung mit dem Tröpfeln und Fließen
des Wassers durch seine Trichtern. Forscher an den Universitäten von Zürich und Campinas in
Brasilien stellten einen Roboter mit der Fähigkeit vor, Musik zu erfassen und
danach seine Erfahrungen zu reflektieren.
Er wurde programmiert, innerhalb eines eingegrenzten Gebiets nach
Lichtkegeln zu suchen und seine Bewegungen mit Musik zu begleiten. Durch
Herumstolpern konnte er feststellen, wo die Grenze war, was eine leise und
dissonante Musik zur Folge hatte, und wo die helleren Stellen waren, an denen
die Musik eine Oktav höher kletterte und erhabener wurde. Der Roboter, der
ungefähr acht Zentimeter groß war, hatte somit gewissermaßen ontologische
und epistemologische Eigenschaften. Sein Lernprozeß erzeugte eine
musikalische Struktur, die von der Frustration zur Transzendenz fortschritt,
da er mehr über deren Welt in Erfahrung bringen konnte und zum Licht strebte.
Epen der menschlichen Geschichte spielten sich vor unseren Augen ab. Es gab auch Schauplätze, an denen verschiedene Projekte
präsentiert wurden. Eines der bedeutendsten hatte Kristine H. Burns von der
Florida International University angeregt, die ihre Forschungen in bezug auf
Online-Pädigogik und ihre „wow’em“-Webseite diskutierte. Die schön
gestaltete und informative Seite ermutigt junge Leute, und besonders Mädchen,
mehr über Computermusik zu lernen. Weitere Forschungsgebiete umfaßten die Gestaltung
virtueller Musikräume, bewegungsempfindliche Installationen, dreidimensionale
Klangverräumlichung, Audio-Kodifizierung, Klangverarbeitung und -wahrnehmung,
Wandler und Lautsprecher, intelligente Kompositionswerkzeuge, tempo-empfindliche
Software und Klangsyntheseverfahren. Leider waren viele der Präsentionen fast
unverständlich, und zwar nicht deswegen, weil das Material (wie oft)
kompliziert war, sondern aufgrund der Präsentation selbst. Einer der attraktivsten Themenbereiche der
Computermusikkonferenz wurde in Sitzungen über die Ästhetik der
Computermusik behandelt, die teilweise von Leigh Landy organisiert waren. In
den Aufrufen zur Teilnahme an der Konferenz teilte der Veranstalter mit, daß
„Computermusik weder ein Stil noch eine Genre“ sei. Zwei
Musikwissenschaftler aus Dänemark meinten, daß die Computermusikkonferenz ästhetisch
vorbelastet sei. Sie orientiere sich an der „akademischen Computermusik“,
die sich ganz auf den abstrakten Klang konzentriere, der von den neueren
Technologie-Entwicklungen hervorgebracht werde. Ingeborg Okkels und
Anders Conrad glauben, daß diese „Ingenieur-Komponisten“ vor
anderen Gruppen bevorzugt werden, zum Beispiel vor denen, die der
amerikanischen Tradition der experimentellen Musik folgen (z.B. John Oswald und John
Zorn), die meistens technisch simple Geräte wie Sampler benutzen, um
kulturelle Artefakte zusammenzustellen. Indem sie auf die neueste Technologie
setzt, trifft die Computermusikkonferenz stillschweigend ästhetische
Entscheidungen. Es war offensichtlich, daß der Technologie manchmal ein höherer
Status beigemessen wurde als musikalischer Qualität und daß Komponisten
dadurch angestiftet wurden, ihre Werke als technologischer auszugeben als sie
wirklich sind. Die Computermusikkonferenz löscht damit ihre eigene Geschichte
aus, weil musikalisch wertvolle elektroakustische Werke, die ohne viel Technik
auskommen, kaum aufgeführt wurden. Ein Stück von Karlheinz Stockhausen zum
Beispiel, der ein enormes Vermächtnis hinsichtlich der elektroakustischen
Musik hinterlassen hat, wurde auf dieser Konferenz in Deutschland weder aufgeführt
noch war der Komponist selbst anwesend. Okkels und Conrad meinten, daß der
Preis, der für die Bevorzugung der „Inginiuer-Komponisten“ gezahlt würde,
der sei, „daß der ‘Ingenieur-Weg’ die Zuordnung der seriellen Musik zur
Experten-Kultur nur in die Computermusik hinein“ verlängere. Friedrich Kittler von der Humboldt-Universität in Berlin,
einer der weltweit anerkanntesten Medienhistoriker, diskutierte die Beziehung
zwischen Technologie und Krieg. Er gab seiner Auffassung Ausdruck, daß die
Computermusik aus dem gleichen Milieu kommt wie die „Männer in weißen
Kitteln“, die für den militärisch-industriellen Komplex arbeiten. Er regte
an, daß wir für unser eigenes Wohlbefinden mehr über die soziale Bedeutung
der Technologie und die „Ontologie der Denkmaschinen“ lernen müssen. Natasha Barrett, eine Engländerin, die in Norwegen lebt,
erläuterte ihre Methoden, kompositorische Strukturen auf natürliche Phänomene
zu beziehen, zum Beispiel auf mathematische Modelle von Lawinen oder die räumliche
Distribution von Tierlauten in tropischen Regenwäldern. Im Gegensatz dazu
sprach der Kanadier Barry Truax von der Fähigkeit des Computers, Formen eines
inneren Theaters darzustellen und zu schaffen. Da Computermusik eine sehr präzise
Klangkontrolle erlaube und keine Interpreten benötige, führe sie auf natürliche
Weise in eine innere Welt, die sehr real ist, einzig real im Gegensatz zur
Trickwelt der Virtuelle dreidimensionalen Realitäten, bei denen wir immer
daran denken, daß irgendwo im Hintergrund ein Computer anwesend ist. Obwohl fünf von neun Ästhetik-Vorträgen von Frauen
gehalten wurden, war an der großen Abschlußdiskussion, die von sechs weisen
Professoren bestritten wurde, keine Frau beteiligt. Wie auch immer die Zukunft
der Computermusik aussehen mag, scheint es, daß Frauen immer noch aus ihr
herausgehalten werden. Nur vierzig von 499 Mitgliedern der ICMA sind Frauen
– oder acht Prozent. Interessanterweise stammten siebzehn Prozent der auf
der Konferenz vorgestellten Kompositionen, die aus anonymen Einreichungen von
über sechshundert Bewerbern durch eine Jury ausgewählt wurden, von Frauen
– mehr als doppelt soviel, wie sie Mitglieder in der Organisation zählen. Unter den ausgewählten Kompositionen gab es zwei
Kategorien, von denen die eine ausschließlich elektroakustische Klänge und
die andere Elektronik mit Solisten oder kleinen Kammerbesetzungen zugrunde
legte, wobei etwa zwei Drittel klassische „Tonbänder“ und ein Drittel
eine Form von „interaktiver“ Elektronik – gewöhnlich mit den Programmen
MAX oder Super Collider geschrieben – verwendeten. Sowohl in der Matthäus Kirche als auch in der Akademie
der Künste, wo die Stücke aufgeführt wurden, waren ausgezeichnete oktophone
Anlagen installiert. Aufgrund der ästhetischen Orientierung des Programms gab
es keine Stücke für Ensembles von elektronischen Instrumenten, und nur sehr
wenige beschäftigten sich auch nur entfernt mit der Unterteilung einzelner
Tonhöhen und verschiedenen Ausprägungen metrischer Rhythmen. Im Zentrum
stand dagegen die klangfarbliche Gestaltung von Klängen. In der Tat gab es
eine Reihe von Komponisten mit wissenschaftlichem oder technischem Hintergrund,
die kaum eine „richtige“ musikalische Ausbildung genossen haben. Die Komposition „Voices Part II“ von Todor Todoroff
aus Belgien beschwor Erinnerungen aus seiner Kindheit, in der er kleine Radios
gebaut und gehört hat. Delikate sinusförmige Glissandi erinnerten an die
Sendersuche in alten Radios, während geisterhaft verrauschte Stimmen sich zu
enormen Rechteckschwingunen aufbauten. „Shatter“ von Marc Ainger aus den
USA beeindruckte durch die Emulation von zerbrechendem Glas und berstenden
Metallobjekten, die von den Klängen schwerer Maschinen begleitet wurden. Das
Stück baute sich zu einer „cyberdelischen“ Vision eines Metallfraßes
auf, außerirdische Termiten, die einen Müllplatz verheeren, aber der
Komponist wußte offensichtlich nicht ganz, wie er das Stück abschließen
sollte. Am Ende ging das geräuschvolle Kauen in einem rostigen Regensturm
unter. Dagegen war die „Music for Hi-Hat and Computer“ von Cort Lippe aus
den USA eines der wirkungsvollsten „interaktiven“ Stücke der Konferenz.
Aufgrund seiner reichen Obertonfülle kann das Becken sehr wirksam gefiltert,
in der Zeit gedehnt und klangfarblich wie -räumlich durch ein Programm der
Sprache MAX MSP vielfältig verändert werden. Das Stück hatte
improvisatorischen Charakter und war gegen Ende eher repetitiv. „Sotto/Sopra“
von Richard Karpen aus den USA war ein interaktives Stück für Violine und
Computer, das ähnliche Technologien verwendete und aufgrund seines
raffinierten Geigenparts, der von Iliana Göbel ausgezeichnet gespielt wurde,
bemerkenswert war. „Entropy“ von Christopher Dobrian aus den USA für
Disk-Klavier und Videoprojektion fiel deshalb auf, weil es eines der wenigen
Stücke war, das ausschließlich eine Reihe von zwölf Tonhöhen ohne
klangfarbliche Veränderungen verwendete. Das MAX-Programm erzeugte
faszinierende, von Menschenhand unspielbare Gesten, die über die Tastatur
fegten. „The Voice of The Phoenix“ von Gordon Monroe aaus Australian, für
Tonband und eine Kontrabaßflöte das sich von einem Stackel auf dem Fußboden
zur Größe von 1,80 Metern erhebt, bevor es sich wieder über ein riesiges
Dreieck wieder zum Mund des Interpreten zurückbiegt, war deshalb interessant,
weil das akustische Instrument viel exotischer war als die elektronischen Klänge,
die es umringten. Monroe, Professor der Mathematik, komponiert eine sehr
differenzierte Musik, auch wenn er – vielleicht in einem Übermaß an
Bescheidenheit – im Gespräch erwähnte, daß er nicht wüßte, wie man
einen verminderten Septakkord auflöst. Der deutsche Komponist Ludger Brümmer stellte zusammen
mit der Videokünstlerin Silke Brämer ein gut aufgenommenes und sehr
anspruchsvolles Werk für Videoprojektion und Lautsprecher vor, wobei er eine
Software benutzte, welche die Erzeugung von Klang und Videobildern aufeinander
bezieht. Francis Dhomont aus Kanada stellte eines der besten Werke
der ganzen Konferenz vor. Ausgehend von Samples verschiedener Flötentypen
stach es durch seine außerordentlich wohlproportionierte Form hervor, die
eine interessante Vielfalt subtil gearbeiteten Materials mit Sinn für
Spannung und Entspannung vereinte und vom Komponisten am Mischpult
eindrucksvoll verräumlicht wurde. Die ICMA hat keinen Fehler gemacht, als sie ihren
Kompositionsauftrag für diese Konferenz an Elizabeth Hoffmann aus den USA
vergeben hat. Ihre eindrucksvolle Stück „Manhattan Breakdown“ für
Klarinette, Violoncello, Schlagzeug, Tonband und Live-Elektronik untersuchte
Improvisationsstrukturen, die auf vorherbestimmten Elementen beruhen und eine
freie Zeitgestaltung zwischen der Aufführung und dem Tonband ermöglichen.
Die Arbeit zeigte das weite Spektrum der ihr zur Verfügung stehenden
kompositorischen Mittel. Gegen Ende der Konferenz wurde die Musik aufgrund der ästhetischen
Begrenzungen ihres Programmschemas eher voraussagbar. Der Eindruck von
Homogeneität kam auch deshalb zustande, weil viele die gleichen
Syntheseprogramme verwendeten – vor allem MAX und Super Collider. Diese
Programme sind sehr flexibel, aber das Komponieren mit „patches“[1] kann
ästhetische und epistemologische Vorlieben für bestimmte Arten von Klängen
und Effekten schaffen. Ein tusche-ähnliche Klangmaterial, erzeugt durch
stotternde „Granulation“[2], die durch gleitende, modulierende Klangfarben
gestaltet werden, war allgegenwärtig, genauso wie improvisierte Echtzeit-Verräumlichungen
am Mischpult. Wenn es eine allgemeine Schwäche der Musik gab, lag sie in der Form. Klangfarbenstudien sind in der westlichen Musik relativ neu und daher gibt es für ihre Struktur nur wenige Vorbilder. Nachdem ihm dieses Problem schon in früheren Konferenzen aufgefallen war, machte Ian Whalley aus Neuseeland den Vorschlag, daß man System-Dynamik-Modelle benutzen könnte, um narrative Strukturen für die Computermusik zu erzeugen. [Siehe Abbildung.] Er demonstrierte diese Idee anhand computerisierter Flußdiagramme welche die Strukturen von Stücken wie Shakespeares „Hamlet“ wiedergaben.
Diagram courtesy of Ian Whalley
Probleme bleiben dennoch, weil man immer noch etwas
Semiotisches (Zeichen und Zeichengeber von metaphorischen Bedeutungen) braucht,
um die Strukturen zu bilden. Die Klangfarbe, die im Zentrum der meisten
Computermusik steht, wird nicht mit der gleichen Fülle an semiotischen
Bedeutungen assoziiert wie Tonhöhe oder Rhythmus. Die Gründe dafür mögen
nicht nur kultureller Natur sein, sondern haben auch etwas mit den kinästhetischen
Eigenschaften von Musik zu tun. Vielleicht der Wichtigste bleibenden Eindruck, den die
Konferenz hinterlassen konnte, war das Ausmaß, in dem der Computer die Musik
körperlos macht. In seinem Grußwort sagte Joel Chadabe: „Wir wollen ein
holistisches Instrument, das den Geist beansprucht und unabhängig vom Körper
ist. Wir können die Klänge einer ‘cityscape’ erzeugen. Wozu braucht man
dann noch einen Körper?“ Obwohl er nicht gegen den Körper ist, sprach er
von ihm als unnötiges Hindernis für das Musikmachen, eine Begrenzung für
die Freiheit des Geistes.
Einige glauben, daß dieser Ansatz auf falschen Annahmen,
was der Mensch sei, beruhen. In den letzten beiden Jahrzehnten haben kognitive
Psychologen wie George Lakoff vorgebracht, daß es keine cartesianische,
dualistische Leib-Seele-Lehre gäbe, die Geist und Körper in metaphysischem
Sinn getrennt sein läßt. Der Verstand ist nicht körperlos. Seine
eigentliche Struktur ist den Einzelheiten unserer Verkörperung entlehnt.
Philosophen wie John Dewy und Maurice Merleau-Ponty sehen den Körper ebenso
als untrennbar vom Verstand an, als eine erste Instanz, die alles gestaltet,
was wir meinen, denken, wissen und mitteilen. Wir können feststellen, daß es kein Schnellverfahren
gibt, den Körper in die Musik einzubringen, und dass wir ohne den langen,
existentiellen Prozeß das Instrument Leib und Seele zu vereinigen, die
kognitiven Strukturen abschwächen, welche das Wesen musikalischer Bedeutung
darstellen. Technische und ästhetische Strategien zur Lösung dieses Problems
werden die Zukunft der Computermusik bestimmen. Übersetzung: Gisela Gronemeyer [1] Ablietung
von “patchcord” -- ein Überbleibsel
aus Frühen Tagen, in denen die Module analoger Synthesizer durch Stecken von
Kablen auf einem Steckfeld miteinander verbunden wurden. [2] Schnelle
Widerholungen eines kurzen Samples zur Erzeugung eines kontinuierlichen Klangs.
|